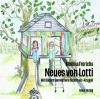Heftige Diskussion um Artikel der NWZ über 'Gefangen in seiner Zeit'
Eine heftige Diskussion über einen Artikel der NWZ über Buch und Premiere des neuen Romans 'Gefangen in seiner Zeit' hat in der Zwischenzeit eingesetzt. Auf der Veranstaltung hatte ein 'Zeitzeuge', von Beginn an versucht, das Buch als unwahr darzustellen. Der anwesende Redakteur meinte seine Behauptungen ungeprüft aufgreifen zu müssen und so einen Artikel zu verfassen, der zum einen einfach falsche Aussagen enthält, zum anderen eine spezifische Tendenz vertritt, die auch der Zeitung unwürdig ist.
In der Zwischenzeit gibt es eine Reihe von Reaktionen, die die Tendenz des Redakteurs und des angeblichen Zeitzeugen verdeutlichen.
Hier erst einmal der Artikel der NWZ
Passform für möglichst viele Schicksale
Andreas Rüßbült liest aus seinem Debütroman „Gefangen in seiner Zeit“
In den Details gehe der gute Roman an der Realität vorbei. Das bekundete ein Zeitzeuge.

Brake „Die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus ist wieder populärer geworden“, sagt Verleger Alfred Büngen vom Geest-Verlag zu Beginn der Lesung von Andreas Rüßbült im Landhaus Hammelwarden. Büngen bezieht sich dabei unter anderem auf den Erfolg des Dreiteilers „Unsere Mütter, unsere Väter“, der fast nur positive Kritiken bekommen habe. Nah den Anklagen versuche man nun, die Frage des „Warum“ zu klären. Dies versuche auch Rüßbült, so Büngen.
„Gefangen in seiner Zeit“ ist die fiktive Geschichte des Brakers Heinrich Cohrs, eines Mitläufers. Der Ich-Erzähler nimmt den Leser mit in die Zeit der Judenverfolgung und des Zweiten Weltkrieges. Knapp 440 Seiten und 19 Jahre erzählte Zeit umfasst das Erstlingswerk des Brakers. Die Fiktionalisierung der Vergangenheit, basierend auf eigener Recherche, Gesprächen mit Zeitzeugen und Fachliteratur bietet den Vorteil, dass gezielt bestimmte Charakteristika herausgearbeitet und in eine ansprechende und gut lesbare Form gegossen werden können. Die ersten Reaktionen scheinen zu zeigen, dass Rüßbült dies gelungen ist. Seit Erscheinen des Buches mehren sich die Kommentare von Lesern, die sagen, dass genau ihre Geschichte im Buch verarbeitet worden sei.
Aber auch kritische Stimmen gibt es. Auf der mit knapp 40 Zuhörern recht gut besuchten Lesung im Landhaus Hammelwarden sind auch Zeitzeugen anwesend. Schon während der Lesung schüttelt ein Zuhörer immer wieder mit dem Kopf, vor allem dann, wenn es um historische Abläufe und persönliche Beweggründe geht. Hier zeigen sich die Nachteile der Romanform und der Fiktionalisierung: Zu Gunsten eines roten Fadens und eines gewissen Spannungsverlaufes muss man fast zwangsläufig auf zu genaue historische Darstellungen verzichten. Wo die Fiktion als Passform für möglichst viele Schicksale gelten kann, da schließt sie auch viele Erfahrungen mit aus.
Entsprechend skeptisch war der Zeitzeuge auch schon vor der Lesung, wie er im Gespräch mit der NWZ anmerkte: „Es ist ein Roman und als solcher sicherlich gut, aber in den Details geht er zu weit an der Realität vorbei.“ Eben diese Unterscheidung ist, das erkennt auch der Zeitzeuge an, wichtig: „Gefangen in seiner Zeit“ sei ein literarischer Versuch, die Zeit des Nationalsozialismus zu ergründen, und kein historisch akkurates Fachbuch.
Als literarischer Versuch der Auseinandersetzung scheint das Buch auch gut anzukommen. Viel Applaus erntet Rüßbült am Ende der knapp zwei Stunden dauernden Lesung – und andere, kritische Anmerkungen bleiben aus.
*****************
Reinhard Rakow schreibt dazu in einem Leserbrief an die NWZ
Dass Zeugen nicht immer Wahrheit bezeugen, weiß jeder, der schon einmal einer Gerichtsverhandlung beiwohnte. Nicht selten liefern drei Zeugen von ein und demselben Vorfall vier oder mehr Versionen - meist nicht einmal bösgläubig, sondern guten Willens und mit der Inbrunst vollster Überzeugung. Nur, ach, die Erinnerung trog.
Dass dieses Phänomen auch bei Zeitzeugen anzutreffen ist -- und meist sogar, wegen des längeren Abstands zum zu erinnernden Geschehen, in verschärfter Weise -- sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Die Eigenschaft "Zeitzeuge" steht ja nicht für einen Beruf, schon gar nicht für einen mit Qualitätsnachweis. Manch einer meint nur zu erinnern, was er an angeblich Erlebtem so lauthals widergibt. Vorsicht im Umgang mit Zeitzeugen ist also angebracht, gerade wenn es darum geht, deren Bekundungen zum sensiblen Thema Nazi-Zeit ein mediales Feld zu bereiten. (Dass dies der NWZ durchaus bewusst ist, hat sie etwa in Wildeshausen bei der Enttarnung eines angeblichen KZ-Insassen als Märchenerzähler unter Beweis gestellt.)
Wie Claus Arne Hock seinen Beitrag zu Andreas Rüßbülts Romanpremiere füllt, muss in diesem Lichte verwundern und verärgern. Nicht nur, dass er aus der Vielzahl der Premierengäste den einzigen "kritisch kopfschüttelnden" herausgreift, um sich dessen Einstellungen fortan aufgebläht zu eigen zu machen. Schlimmer noch: Er übernimmt den Wahrheitsgehalt des ungenannten angeblichen Zeitzeugen völlig unkritisch und ungeprüft. Das ist schlechter Journalismus. Daraus überdies das Verdikt vermeintlicher historischer Schludrigkeit des Romans zurecht zu zimmern und es dem arglosen Leser als wahrhaftig unterzuschieben, ist mehr noch als bloß oberlehrerhafte Beckmesserei. Es ist tendenziös. Hinzu kommt nämlich, dass der Artikel zu dem zentralen Thema und zu dem großen Verdienst des Romans von Andreas Rüßbült kein einziges Wort verliert: Gestützt auf Fakten, in literarisiert eingängiger Weise verstehbar zu machen, wie es kommen konnte, dass unsere Vorfahren ihre Mitmenschlichkeit verloren und zu Mittätern wurden.
*****
Eine Reaktion eines Besuchers der Lesung auf den NWZ Artikel:
Der angebliche Zeitzeuge, der in der Reihe hinter mir saß und mehrfach Kommentare während der Lesung abgab, ist für mich nicht glaubhaft. Gefühlt war er 70 Jahre alt. Wie will er die Geschehnisse rund um 1933 erlebt haben? Um selber dabei gewesen zu sein, müsste er etwa 90 Jahre alt sein.
Inhaltlich hat er in der Lesung angemerkt, dass vor 1933 eine Hitlerjugend nicht existierte. Dies ist aber nicht korrekt, die gab es auch vor 1933. Zudem sei eine Beflaggung Bremens mit der von Andreas so genannten "Blutflagge" erst in den 40ern erfolgt. Auch das widerspricht Bildmaterial aus der Zeit.
Trotz der Romanform für das Buch muss ich Andreas bescheinigen, dass er die sachlichen Fakten sehr gut recherchiert hat. Die Kritik des angeblichen Zeitzeugen mag ich nicht teilen.
Claus Hock als Redakteuer des Artikels hätte die kritischen Anmerkungen vielleicht etwas besser recherchieren sollen?