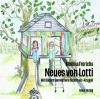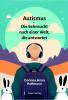KATHARINA KÖRTING SCHAU MAL IM POSTKORB NACH Zu Reinhard Rakows Gedichten
KATHARINA KÖRTING
SCHAU MAL IM POSTKORB NACH
Zu Reinhard Rakows Gedichten
Mit seiner „ode vom auslesen“ kredenzt Reinhard Rakow ohne Vorwarnung, gleich zu Beginn des dritten Bandes, einen Aperitif „in formaldehyd“, eine Ouvertüre für „die gehirne“, eine scheinbare Anverwandlung des Bösen. Auch hier zeigt er sich als ein Zauberer des Entzauberns. Als sei es Bedingung, den Zauber des Lebens wahrhaftig zu erlesen: Erst kommt das Hinschauen, und dann kommt die Moral.
„Also reden wir über den Schatten“, der sich zu ausgespienen Mäusen gesellt (Ich bin der, Band 3), zu Erbro-chenem, Verlorenem, zu all der ausgeschwitzten Hoff-nung, die sich nicht fortwischen lässt, mit keinem Handtuch der Welt: Da ergibt sich kein gepflegtes Gespräch, womöglich in Handschuhen und in der sicheren Distanz. Kein Benimm, nirgends. Aber keinen Benimm muss man sich erst mal leisten und trauen. In Reinhard Rakows lyrischem Universum zählen keine Formalitäten, da zählt die Form, und die muss für den Inhalt passen. So schleicht sich auch das ein oder andere Sonett in die Seiten. Eines erklärt die Zeit ein für alle Mal zum Gespenst: „Und jenes Heulen in den langen Röhren? / Und dieses Klappern aus dem dusteren Saal? / Es ist eine Erscheinung, sich win-dend wie ein Aal – / Man darf sie weder sehen noch stören.“ (Das Schloss, Band 2) Und doch stört er sie, dieser Dichter, immer wieder, diese Zeit, mit seiner politischen Lyrik, mit seinen Beziehungsgedichten, mit seinen gereimten oder ungereimten Nachdenklichkeiten und erschütternden Be-Findlichkeiten. Und lässt sich (ver)stören von ihr. Manche Gedichte fühlen sich ganz nah an, andere machen ärgerlich, dem Dichter oder der Welt gegenüber, die dem lyrischen Ich so viel Leid angetan, wieder andere trösten in ihrer Trostlosigkeit, und immer wieder verblüfft das völlige Fehlen von Todessehnsucht: Da ist so viel Lebensliebe, in all dem Hadern, noch in der gräulichsten Beobachtung - wunderbar!
Die Mäuse huschen derweil durch die Alte Fabrik. Dane-ben kriechen „schwarze armaden / langgliedriger af-fen“ (von den hügeln die affen, Band 1) an den Hängen und Häusern, die man so wenig packen kann und so we-nig los wird wie die vertrackte Angst. Da fallen die Blätter mitten im Sommer wie Baudelaires Blumen des Bösen, und sei die Leserin, der Leser noch so scheinheilig – hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère! - ihrem Duft kann er, kann sie sich schwerlich entziehen.
Was bei Baudelaire der Ennui, wird für Rakow die Leere. Sie will besungen sein, hallt es doch so schön in ihr – wo sonst (außer, vielleicht, in der Liebe) gäbe es eine solche Akustik! „woher rührt sie, diese leere (…) dieses wahnhafte starren auf das was kommt, wo man / doch weiß, es kommt nicht“. Und was passiert, wenn das Schlimmste eintritt, „vor leere nicht mehr um / Verzeihung bitten zu können“? (DER BAHNHOF ZU G., Band 2)
Die Leere braucht eine Menge Raum. Reinhard Rakow gibt ihn ihr. Er gibt sie, er gibt es uns, seinen Leserinnen und Lesern. Teilt eine Einsamkeit, die nicht zu heilen, aber zu besingen ist, „ein graues tier mit nagezäh-nen“ (EINSAMKEIT, Band 2), womit wir flugs wieder bei den Mäusen wären, „an feiertagen ist es am ärgsten“. Man kennt das, leider. Und es ist gut, wenn da kein Schwamm drüber kommt, sondern ein Gedicht, das sich gewaschen hat. Und man denkt gar nicht, auf den ersten Blick, dass das keine Prosa ist, so dicht und so flüssig ist das Glück beim Lesen auf kleinstem Raum, der immer genug Platz lässt für das nie Eintretende, das Herbeigesehnte, für jene untilgbare Sehnsucht, es möge besser werden, und für den unnennbaren Schmerz, dass alles noch lange nicht gut ist – und auch nicht wird.
Rakow wendet den Blick nicht ab, er schaut genau hin: auf die Bedrängten, auf diejenigen am Rand (den es im Grunde so wenig gibt wie die missbrauchte Mitte), auf die Gefährdeten, Gequälten, Zerstörten, auf abwegige Lebewesen, oder auf jenes Kind, auffällig geworden durch „seinen klaren blick aus einem wasserkopf“ (ode vom auslesen, Band 3)
Das lässt er so stehen und (es) gibt keinen Trost, jedenfalls nicht vordergründig, auch wenn ihm immer wieder die Liebe dazwischenkommt, denn diese Lyrik liebt mit unverhohlener Hingabe. „ich liebe dich / ich beiße dich / ich geige und ich heize dich /ich kreise dich“ (vokalisches bekenntnis, Band 3)… und weiß dabei doch, dass jedes Für Immer nur ein tödliches sein kann: „Wir hielten uns fest. / Und ein Schatten fiel. / Und er stürzt’ aus dem Licht, / Zersplittert, zur Strafe, / So als spürten wir nicht // Dass unsre Liebe, wie er, dem Tod glich.“ (AHNUNG, Bd. 3)
Das fließt und das stockt und das ringt – „schau hin, wie die Dinge ringen“! (FAHRT, Bd. 3) - Da wirbeln die Sil-ben, die Worte umeinander, und wenn man dann nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, setzt er noch einen drauf – oder kriegt die Kurve ins unvermittelt Weiche, Ruhige, impressiv Expressive oder expressiv Impressive, je nachdem: „Und blau ziehen Bäume zum Horizont“ (FAHRT, Band 3).
Den Zeilenumbruch beherrscht er meisterlich, hat ein unbestechliches Gefühl für Rhythmus, mit dem er jedoch nicht das zu Sagende hintergeht zugunsten eines Schönklangs, eines Kniffes, einer Auflösung. Nie erliegt er der Versuchung, etwas Raues zu glätten, weder in den ganz kurzen, noch in den sehr langen Gedichten. Denn er weiß: „nimmst du das Kantenglätten / Für dich erstmal in Kauf / Zählst zu den lieben Netten / Legst dich in wei-che Betten / Wir können gerne wetten: [Dann stehst du nicht mehr auf! Nein:] Damit gibst du dich auf.“ (Stillehre, Band 1) Und aufgeben – gilt nicht!
Die „Ode an alle“ (Band 3) , selbstbewusst einem gewis-sen Bertolt mit dem Zaunpfahl zuwinkend, und auch ei-nem gewissen Walt, beschließt den dritten und letzten Band: „Was sind das für Zeiten, da ein Gespräch über / Forsythien fast ein Verbrechen ist, weil es so viel / Wich-tigeres gibt“. So viel Wichtigeres! Dieses lange Gedicht besingt das Wichtigsein all der Vergessenen, Vernachläs-sigten, Verstorbenen, Kämpfenden, Liebenden, Leidenden, Gläubigen, Verstummten, Hungernden, Betuchten an den verschiedenen Orten der Erde, ertrotzt sich inmitten der Pandemie keine neue Normalität, sondern eine neue Solidarität, fordert einen Fortschritt, der die Erinnerung nicht vergisst, Vorwärts, und nicht vergessen!, trotz allem, auch wenn es unmöglich scheint, auch wenn es eine Anmaßung ist, denn jedes Atom, wusste Whitman, gehört auch dir. Rein-hard Rakows Lyrik weiß es, in beeindruckender Weise, auch – und scheut zum Glück das Pathos nicht, das er selbst immer wieder zertrümmert, drückt sich auf dem Boden der Tatsachen herum und schaut von dort aus ver-zückt in den Himmel, denn „himmel ist oben“ (Gedichtti-tel, Band 2). Was er scheut, ist das Hohle, ist die Lüge, ist das Seichte, denn das verbietet sich, in diesen Zeiten, in denen ein auf Rosen gebetteter Vers ein Verbrechen wäre, „während ein junkie verzweifelt“ (17 uhr 40, deutschland-funk, Band 1), der keinen Schutzengel hat. Und bei all dem Unbill, bei all dem Schlimmen, bei all dem, was man eben einfach nicht so stehen lassen darf, ohne sich dar-über zu erregen kann Glück passieren, das tarnt sich mit-unter als Alltag: „Trotzdem / heil aufgewacht. / Und du bezweifelst // Dass es Schutzengel gibt?“ (Tage wie heu-te, Band 1)
Daran kann es, bei allem Zweifel, keinen Zweifel geben, so lange es eine so schutzlos liebende Lyrik gibt. Also: „schau mal im postkorb nach / ob du noch lebst“! (out-look, Band 1) Oder, besser noch, in Reinhard Rakows Gedichten – viel Glück beim Lesen!
aus:
Reinhard Rakow
ODE AN ALLE
Gedichte 3
Ausgewählte Gedichte Band 3
Nachwort von Katharina Körting
Geest-Verlag 2021