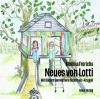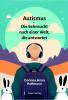Presseinfo Katharina Körting - Liquidierung der Vergangenheit
Presseinfo v. 05.03.2021
Katharina Körting
Liquidierung der Vergangenheit.
Wie sich die evangelische Kirche
auf den Grundlagen ihres Versagens restaurierte
Geest-Verlag 2021
ISBN 978-3-86685-831-2
260 S., 14,80 Euro
"Dies ist kein Text über den kleinen protestierenden Widerstand, sondern über das große protestantische Schweigen vor 1945, und das Verschweigen dieses Schweigens nach 1945."
Mit diesen Worten leitet Katharina Körting ihr Buch über das Verhältnis der evangelischen Kirche zum Nationalsozialismus nach 1945 ein. Mit akribischer Genauigkeit, das Buch hat allein über 550 Quellenhinweise, geht sie diesemVerhältnis nach. Dabei kommt sie zum Ergebnis, dass (aller regionalen, personellen und kirchengruppenbezogenen Besonderheiten und Unterschiede sich bewusst seiend), der Kirche vorzuwerfen ist, dass über das Miteinander von Kirche und Nationalsozialismus kaum jemand wirklich aufrichtig gesprochen hat und bis heute nicht spricht. Wenn gesprochen wurde, ging es zumeist um das Anliegen, sich reinzuwachsen von der nationalsozialistischen Schuld, nicht aber darum ausreichend öffentlich zu reflektieren und zu thematisieren, inwiefern man selbst am Entstehen der braunen Grundtheoreme beteiligt war, sie zumindest nicht verworfen und bekämpft hat. Eine angesichts heutiger antisemitischer und faschistischer Entwicklungen mehr als wichtige wissenschaftliche Arbeit, die nicht Institutionen oder Personen angreifen will, vielmehr die dringende Notwendigkeit offener und ehrliche Reflexion offenbart, um solchen antidemokratischen Entwicklungen rechtzeitig vorzubeugen.
Katharina Körting, Jahrgang 1968, M. A. phil. (Philosophie u. a.), schreibt Prosa, Lyrik und journalistische Texte. 2019 erhielt sie den Sonderpreis „Bester Essay“ der Siebten Berner Bücherwochen. 2020 berief man sie in die Jury des Ulrich-Grasnick-Lyrikpreises.
Die Autorin ist katholisch getauft, kirchenfern aufgewachsen, 2009 ausgetreten und seit 2011 Mitglied der evangelischen Kirche. Im Reformationsjubiläumsjahr war sie in Lutherstadt Wittenberg beim dortigen Kirchenkreis als Reformationsbeauftragte unterwegs. Hier und da betätigt sie sich als Lektorin in Gottesdiensten. Sie hat vier Kinder und lebt in Berlin.
Der Inhalt des Buches:
Martin Luthers Vermächtnis
Ein Fresko in einer traditionsreichen Dorfkirche
Der Erste Weltkrieg als Gottesoffenbarung
Was hat Luther mit Hitler zu tun? Wenig erforscht, kaum gewusst
Buße?
Wie Kirchenführer einander in Ehren halten
Mitmachen aus Überzeugung: Zum Beispiel Joachim Hossenfelder
NIE WIEDER? Zum Beispiel Karl Themel
Die Kirche im Netz: Erinnerungskultur?
Passiv Juden hassen, aktiv leugnen und Hauptsache Ordnung: Zum Beispiel Otto Dibelius
Deutscher Luthertag 1933 und die antibolschewistische christliche Leitkultur
Weihnachten im Krieg: Die Banalität des Guten
Kollaborateur aus Opportunismus: Zum Beispiel der Lutheraner Heinz Brunotte
„Fehler sind gemacht worden“: Zum Beispiel der Lutheraner August Marahrens
Und dann hatte die Kirche plötzlich nichts mehr damit zu tun?
Antisemitische Schmierereien im Kalten Krieg
Antijüdische lutherische Leitkultur
Verlegenheit, Enthaltung, taktische Zurückhaltung: Der Eichmann-Prozess
Das war damals so: Bestandsbewahrung hat Priorität
Der neue Anfang: Halbherzig Schuld bekennen und mit voller Kraft ententnazifizieren
Evangelische Lehre und Forschung: Das „Entjudungsinstitut“ und seine Verdrängung
Abkehr von der Erinnerung: Die zweite Schuld der Kirche
Verfolgte Unschuld: Wie die Kirche sich für NS-Verbrecher einsetzte
„Du sollst nicht gehorchen mit Kant“ Was dabei herauskommt: Drei Beispiele
Kirchlicher Gründungsakt: Verdrängung
„Nie wurde ein Volk so belogen und betrogen“ – mein GroßvaterDämonen im finstern Tal
Heldenverehrung statt Vergangenheitsbewältigung
Das vorliegende Buch von Katharina Körting bildet den Auftakt zu einer neuen Reihe „Lebendige Erinnerung – Bücher gegen das Vergessen“.
Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Geest Verlag Vechta und Kultur vor Ort e. V., Berne, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Gedenken an die Shoah offensiv zu pflegen und so eine dezidierte Position gegen jegliche Versuche der Geschichtsvergessenheit und Geschichtsklitterung zu formulieren.