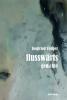Rezension von Thomas Bartsch zu Hans-Hermann Mahnkens Lyrikband „Unter fliehenden Wolken“
„Unter fliehenden Wolken“ lautet der Titel des 2023 im Geest-Verlag erschienenen Lyrikbandes von Hans-Hermann Mahnken. Meine erste Assoziation war das Lied „Über den Wolken“ von Reinhard Mey, in dem der Liedermacher von grenzenloser Freiheit und völligem Losgelöstsein singt. Mahnken jedoch bezieht sich nicht auf höhere Sphären, auf eine Distanz von irdischen Nöten, Sorgen und Zeitebenen. Im Gegenteil: Seine Gedichte sind ganz und gar geerdet. Es geht um Heim- und Fernweh, zärtlich-melancholische Rückschau, Naturverbundenheit, Liebe und Gesellschaftskritisches.
Während ich in die meist weichen Verse eintauche und dabei eigenen Assoziationen Raum gebe, geht es mir, als würde mich von innen eine Bluesmelodie tragen, die mich teils traurig, teils seltsam heiter stimmt und immer ein Gefühl von Kohärenz entstehen lässt. Die Erinnerungsmotive Mahnkens, sei es „am staubigen Bahndamm“ kauernder Löwenzahn, der „Besuch auf dem Land“ mit seiner nachklingenden Liebeserklärung an die tiefe Schlichtheit der „alten Geschichten“, der verstaubte Teddy der Kindheit – all diese Vergangenheitsbilder sind im Erleben des Autors nicht elementar verloren gegangen, sondern leben weiter in einer poetischen Dimension, in der die Grenzen zwischen den Zeiten verschwimmen und essenzielle Sammlung möglich wird.
Dabei bedient sich der Lyriker keiner erst zu entschlüsselnden Metaphorik. Seine sprachlichen Bilder, die sich wohltuend vom Mainstream einer ästhetisierenden Kokon-Lyrik abheben, spiegeln weites Land, einen Fluss, das brandende Meer, den Wind, Gegenständliches und Szenisches.
Hans-Hermann Mahnken verwendet auch traditionelle Stilelemente und schlägt gewissermaßen eine Brücke zur Romantik, deren träumerische Wehmut er jedoch ganz und gar im (eben nicht historischen) Präsens zum Ausdruck bringt. So begegnet mir z. B. Eichendorffs „Mondnacht“ in der „Ulenflucht“: „Schatten lösen sich und gleiten / lautlos in die Nacht / wie vor undenklichen Zeiten / bevor das erste Wort erwacht“.
Ich laufe beim weiteren Lesen aber keineswegs Gefahr, etwa in eine romantisierende Grundströmung, in Strudel einer morbiden Sehnsucht gelockt zu werden. Stattdessen wird mir im „Klagelied“ die Gefahr eines apokalyptischen Krieges und im Gedicht „Vexierspiegel“ das Symptom eines zunehmenden gesamtgesellschaftlichen Sprach- und Empathieverlusts ins Bewusstsein gerückt.
Ich könnte noch weitere Aspekte dieses Lyrikbandes, der mich tief berührt hat, hervorheben, möchte aber nicht die Neugier nehmen, dieses Buch zu lesen – und zu genießen.
Thomas Bartsch