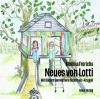Heiko Schulze arbeitet an Osnabrücker Zeitungsgeschichte (Buch und Ausstellung)
Zum Nutzen und Vergnügen:
250 Jahre Osnabrücker Zeitungsgeschichte. Teil 1: 1766-1866
Im Kreißsaal mit der Druckerpresse
Es ereignet sich am 4. Oktober 1776. Tatort ist die Kislingsche Druckerei in der Großen Hamkenstraße 17. In Reichweite einer wuchtigen, nun stillstehenden Druckerpresse ruht ein Stapel Zeitungen. „Wöchentliche Osnabrückische Anzeigen“ steht auf dem obersten der einheitlich gefalzten Papierbögen. Zwei Spalten Text füllen den Rest der Frontseite. Die Falzung deutet darauf hin, dass mehr Lesestoff im Inneren des Blattes zu erwarten ist. Sie ist also da: Osnabrücks erstes Lokalblatt ist geboren!
Der Vater heißt Justus Möser. Der erste Redakteur der Stadtgeschichte ist Jurist, Literat, Historiker und so etwas wie der Regierungschef im alten Fürstbistum. Dies umfasst nur wenig mehr Fläche als das Territorium des heutigen Stadt- und Landkreisgebiets. Der Kleinstaat beherbergt rund 110.000 Seelen, nur knapp 7.000 davon leben in Osnabrück. Die Hebammen der Zeitungsgeburt sind Drucker mit Händen voller Druckerschwärze. Wichtigster Geburtshelfer ist Johann Wilhelm Kisling. Der 56-Jährige ist Verleger und Inhaber der einzigen „Hofdruckerei“ im Osnabrücker Kleinstaat.
1776 hat sie also begonnen, die heute 250-jährige Osnabrücker Zeitungsgeschichte. Viele Städte besitzen eine längere Pressetradition. Ein Buch und eine Ausstellung, die am 8. November dieses Jahres in der VHS eröffnet wird, werden sich dem Thema ausgiebig widmen.
Wir nehmen etwas vorweg: Was war markant an jenem Vierteljahrhundert?
Möser im Facebook-Modus
Ein moderner Mensch, der sich aktuellen Nachrichten auf seinem Monitor oder Display widmet, kann damit mindestens vier Dinge tun: Er kann Neuigkeiten lesen, kommentieren, ergänzen oder weiterverbreiten. Justus Möser, der damals ein klassisches Anzeigenblatt der Regierenden vertreibt, gibt sich nicht mit einem schlichten Verlautbarungsorgan ab. Er krönt den Inserats- und Verkündigungsteil mit etwas Besonderem: einer „nützlichen Beilage“. Damit möchte er nicht nur informieren, unterhalten und belehren. Er möchte vor allem diskutieren. Im modernen Mediendeutsch gesprochen: Er postet persönlich, lässt andere posten, wartet auf Likes oder auf Dislikes zum Regierungshandeln. In Gestalt erfundener Autorennamen gibt der Redakteur unterschiedliche Sichtweisen zu Problemen des Alltags zum Besten. Grundlage der Kontroversen bilden ausdrücklich erbetene Leserzuschriften. Kurzum: Meldungen, Debatten und Pseudonyme, stets mit der Bitte um Weiterverbreitung. Hätte es das „Liken“ schon gegeben, hätte kein Geringerer als Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe zu den „Gefällt-mir-Klickern“ des Osnabrücker Blattes gehört. Denn für ihn ist der erste Osnabrücker Blattmacher schlichtweg „der herrliche Justus Möser“.
Ein Lokalblatt auf Französisch
Kaum einem Osnabrücker ist heutzutage bewusst, dass seine Stadt einmal ganz offiziell zum fernen Frankreich gehörte. 1803 ziehen Soldaten Napoleons in die Stadt ein und bleiben mit Unterbrechungen bis 1813. Im Juli 1807 wird das Osnabrücker Gebiet dem Königreich Westfalen zugeschlagen. Als dessen König regiert Napoleons Bruder Jerome auf der Basis des bürgerfreundlichen Code Civile , der erstmals alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft gleichstellt. Im Jahre 1811 erlebt Osnabrück erneut eine ganz besondere Änderung seiner staatlichen Zuordnung: Die Stadt gehört für rund drei Jahre ganz offiziell zu Frankreich. Die französische Zeit hinterlässt in der Stadt durchaus positive Spuren: Steuern und Abgaben werden gerechter erhoben. Laienrichter werden eingeführt. Überdies werden mehr Straßen gepflastert, die Häuser nummeriert und Friedhöfe jenseits der Stadtmauern angelegt. Im Gegensatz zu vorherigen Besatzungstruppen aus Hannover und Preußen sind Frankreichs Offiziere deutlich darum bemüht, ein gutes Klima zwischen Bevölkerung und Soldaten zu schaffen. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Blatt, das in deutscher und französischer Sprache erscheint: Die Wöchentlichen Osnabrückischen Anzeigen werden bis heute die einzige zweisprachige Lokalzeitung der Stadt bleiben.
1848: Osnabrück pflegt ihn früh, den Parteienstreit
Geschichtskundige wissen, dass die 1863 gegründete Sozialdemokratie die älteste deutsche Partei ist, Vorläufer der Liberalen gibt es mit der Fortschrittspartei gar schon 1861, und mit dem Zentrum gründet sich die erste christliche Partei anno 1870. Allein Konservative können bereits auf Ursprünge im preußischen Landtag von 1848 und auf ihren Stammvater Bismarck verweisen. In anderen deutschen Staaten dauerte die konservative Parteibildung weitaus länger.
Betrachtet man die Osnabrücker Zeitungsgründungen des Jahres 1848, sind derartige parteipolitischen Strömungen in der Hasestadt bereits sehr viel früher als andernorts deutlich erkennbar. Bekennende Linke scharen sich um die Macher der ersten Tageszeitung, dem „Tageblatt für jedermann“. Das Blatt ist das Organ des Märzvereins, spricht auch die wachsende Arbeiterschaft der Stadt an und transportiert bereits früh sozialistische Ideen. Prägende Blattmacher sind der Verleger Lüdecke, der Advokat Detering und die Lehrer Rosenthal und Noelle. Konservative und Konservativ-Liberale gründen den Vaterlandsverein und rufen das „Osnabrücker Volksblatt“ ins Leben. Dessen geistiger Vater ist vor allem der langjährige Bürgermeister und zeitweilige hannoversche Innenminister Johann Carl Bertram Stüve.
Katholiken, die erst ab 1833 wieder das Recht bekommen haben, im Osnabrücker Magistrat vertreten zu sein, finden sich im Piusverein zusammen, der durchaus mit einer frühen christlichen Partei vergleichbar ist. Oberlehrer Dr. Wilken und Domchoral Fredewest bringen als eigenes Blatt die „Beiträge zur Belehrung und Erholung“ heraus, die besonders gern im katholischen Umland gelesen werden.
Alle Blätter begründen in Osnabrück eine breitgefächerte politische Streitkultur: kontrovers, polemisch wie satirisch, aber gepflegt und völlig gewaltlos.
Die zarten demokratischen Ansätze werden nur wenige Jahre später unter feudalistischen Militärstiefeln zertrampelt. Pressefreiheit und geistiger Meinungsstreit nehmen landauf, landab ein brutales Ende. In Osnabrück verbleiben am Ende verbleiben allein die altbackenen Wöchentlichen Osnabrückischen Anzeigen.