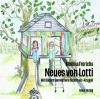Zum Hintergrund: 1. Mai
Der Versuch der Weimarer Nationalversammlung, am 15. April 1919 den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu bestimmen, hatte nur begrenzt auf das Jahr 1919 Erfolg.[5] Für das Gesetz, das nur auf den 1. Mai 1919 beschränkt war, stimmten SPD, DDP und Teile des Zentrums. Während die bürgerlich-rechte Opposition (DNVP, DVP) sowie weite Teile des Zentrums die Einführung des Tages der Arbeit als Feiertag überhaupt ablehnten, ging der USPD das Gesetz nicht weit genug, sie forderte zusätzlich die Einführung des 9. Novembers als Revolutionsfeiertag. Der sogenannte Blutmai (Berlin 1929) ließ die Widersprüche zwischen KPD und SPD deutlich werden.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der 1. Mai ab 1933 durch die Nationalsozialisten zum gesetzlichen Feiertag. Das Reichsgesetz vom 10. April 1933[6] benannte ihn als „Tag der nationalen Arbeit“. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften in Deutschland gleichgeschaltet, die Gewerkschaftshäuser gestürmt und die Vermögen beschlagnahmt.[7] Im Jahr 1934 wurde der 1. Mai durch eine Gesetzesnovelle zu einem „Nationalen Feiertag des deutschen Volkes“ erklärt.
„Am 1. Mai 1933 hält Adolf Hitler eine Ansprache vor Hunderttausenden von Menschen auf dem Tempelhofer Feld. Der Massenaufmarsch ist mit der damaligen grossen Angst vor Entlassungen zu erklären und damit, dass die Auszahlung des Lohns verknüpft wurde mit der Teilnahme an der Demonstration und den Kundgebungen. Der Tag wird vom nationalsozialistischen Regime erstmals zum «Tag der nationalen Arbeit» und damit zum gesetzlichen Staatsfeiertag bei voller Lohnfortzahlung erklärt.“
– Ronnie Grob.: NZZ, 1. September 2016.[8]
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 1. Mai 1946 durch den Alliierten Kontrollrat bestätigt. Maikundgebungen durften jedoch nur eingeschränkt durchgeführt werden.
Der 1. Mai ist in der Bundesrepublik Deutschland nach den Feiertagsgesetzen der Länder ein gesetzlicher Feiertag. Die amtliche Bezeichnung in Deutschland ist durch Gesetze der einzelnen Länder geregelt. In Nordrhein-Westfalen wird der erste Mai staatlicherseits als Tag des Friedens und der Völkerversöhnung bzw. Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde[9] begangen.
In der DDR und weiteren sozialistischen Ländern wurde der 1. Mai als „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“ mit aufwändigen Mai-Paraden begangen und auf die Traditionen der internationalen Arbeiterbewegung verwiesen. Symbol des 1. Mai ist die rote Mainelke.
Seit den 1980er Jahren gab es neben den politischen organisierten Demonstrationen auch regelmäßig Ausschreitungen in der Bundesrepublik, vor allem im Zusammenhang mit der Demonstration zum 1. Mai in Kreuzberg (Berlin).
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Mai
Maifeiertag im Dritten Reich
Im nationalsozialistischen Festkalender nahm der 1. Mai auch in den folgenden Jahren eine wichtige Rolle ein. Seiner früheren Beziehung zur Arbeit oder gar zur Arbeiterbewegung wurde er gänzlich entkleidet. Seit 1934 hieß er „Nationaler Feiertag des deutschen Volkes“. Er sollte ein Tag der Volksgemeinschaft sein. Angeknüpft wurde an angeblich germanisches Brauchtum. Der Erste Mai wurde als Frühlingsfest begangen, wie es in einigen Regionen traditionell üblich war. Die Maibäume wurden mit Symbolen des Regimes wie dem Hakenkreuz oder dem Zeichen der DAF versehen. Gebäude wurden geschmückt und am Feiertag selbst marschierten Umzüge mit Gruppen der SA, SS, Wehrmacht, Hitlerjugend und verschiedenen Abteilungen der DAF durch die Straßen. Hinzu kamen volksfestartige Elemente wie Tanz und Kinderspiele.
Die zentrale Veranstaltung in Berlin war mit Kundgebungen, Flugvorführungen, Musikveranstaltungen, militärischen Vorführungen und abends mit einem großen Feuerwerk verbunden. Daran nahmen angeblich bis zu einer Million Menschen aus allen Teilen Deutschlands teil. Wie bei der ersten Feier 1933 wurde die Festrede Hitlers im Radio übertragen.